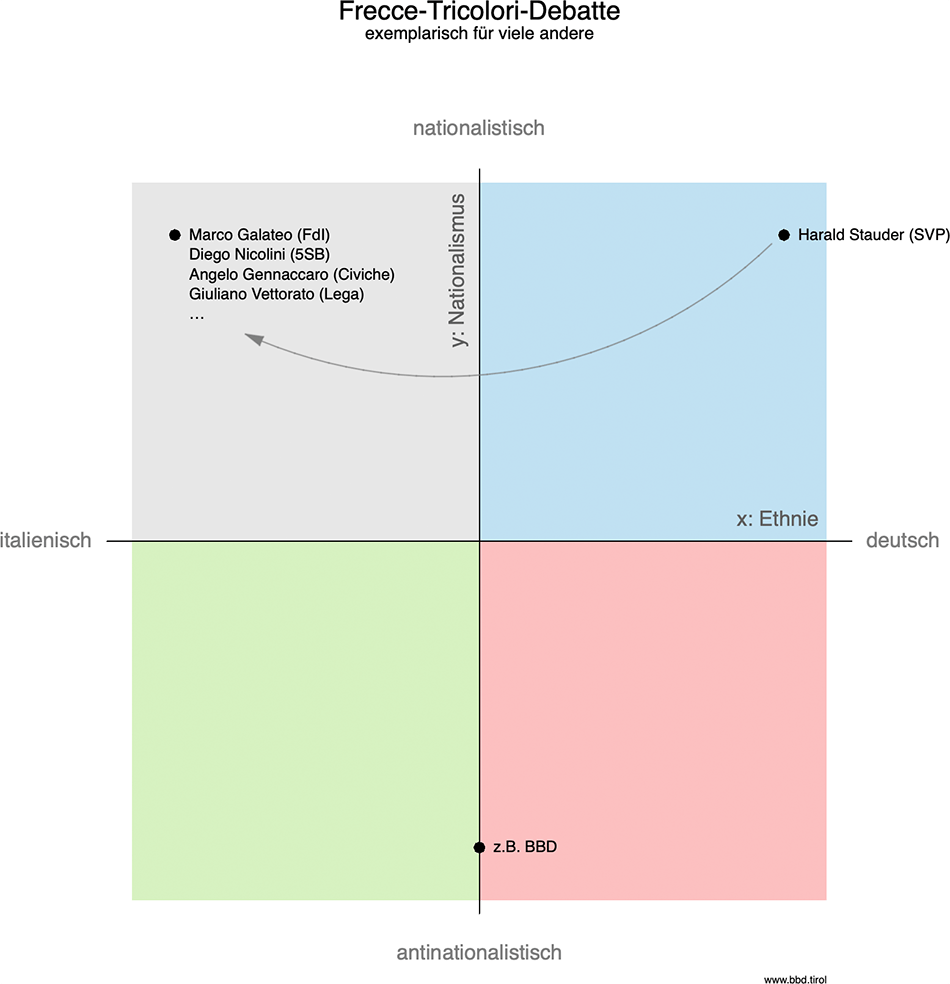Für einen Sportler sollte es die allergrößte Ambition sein, sein eigenes Land zu vertreten. Und das müsse für alle gelten. Wer dies ablehne, um stattdessen anderswo zu spielen, sollte für mindestens ein Jahr disqualifiziert werden. So kommentierte der zweimalige italienische Roland-Garros-Sieger Nicola Pietrangeli kürzlich die Entscheidung von Jannik Sinner, nicht am Davis Cup teilzunehmen, wo sich (anders als sonst im Tennis) Nationalmannschaften gegenüberstehen. Doch wer denkt, dass eine derartige ewiggestrige Auffassung nur von einem Tennisprofi des letzten Jahrhunderts kommen kann, hat sich schwer geirrt — die Meinung ist in Italien mainstream. Praktisch kein Medium, das diesen nationalistischen Schwachsinn wiedergegeben hat, hatte auch nur ein kritisches Wort zu Pietrangelis Äußerungen hinzuzufügen. Im Gegenteil: Journalist Giorgio Specchia von der italienischen Sportbibel Gazzetta dello Sport — kein 90-jähriger Greis — setzte diese Woche noch eins drauf: »Sinner, so geht das nicht.« Der Südtiroler scheine das azurblaue Trikot nicht zu mögen, doch dann werde auch er irgendwann den Azzurri nicht mehr gefallen. Das sei aber die Farbe »die man liebt und Schluss«, rationale Argumente offensichtlich unerwünscht. Wenn der Individualsport Tennis zum »nationalen Faktor« werde, wirke das als Multiplikator für Emotionen.
Nicht im entferntesten kommt irgendjemandem in den Sinn, dass ein Sportler nicht immer und unbedingt für »sein« Vaterland antreten möchte, dass dies sein gutes Recht ist — und dass dies gerade für jemanden gelten könnte, der einer nationalen Minderheit angehört. Stattdessen werden in Italien ja nicht gerade italienisch klingende Namen selbst von öffentlichen Institutionen zum Anlass genommen, die zweifellose (und unbezweifelbare) Italianität der Trägerinnen zu unterstreichen. Dass man damit Menschen — den Sportlerinnen und der ganzen Sprachgemeinschaft gleich mit — ungefragt eine Identität aufoktroyiert, scheint kaum wen zu stören.
Die aggressive Fremdbestimmung und moralisierende Einflussnahme, die bei anderen (sexuellen, religiösen etc.) Minderheiten zum Glück längst geächtet ist, wiewohl es dennoch regelmäßig zu Verstößen kommt, ist bei nationalen bzw. sprachlichen Minoritäten nach wie vor kein Problem.
Wir können das zwar wieder einmal achselzuckend ignorieren, doch der stete Tropfen der Vereinnahmung und öffentlichen Unterdrucksetzung wird letztendlich kaum sein Ziel verfehlen.
Cëla enghe: 01 02 03 || 01 02 03

 , ist nahezu auf verlorenem Posten. Derweil existiert hier nicht bloß keine Brandmauer mehr, sondern es bestehen schon so tiefe Verflechtungen, dass teilweise gar keine inhaltlichen Grenzen mehr erkennbar sind. Bleibt zu hoffen, dass es nicht auch in Deutschland bald so wird.
, ist nahezu auf verlorenem Posten. Derweil existiert hier nicht bloß keine Brandmauer mehr, sondern es bestehen schon so tiefe Verflechtungen, dass teilweise gar keine inhaltlichen Grenzen mehr erkennbar sind. Bleibt zu hoffen, dass es nicht auch in Deutschland bald so wird.