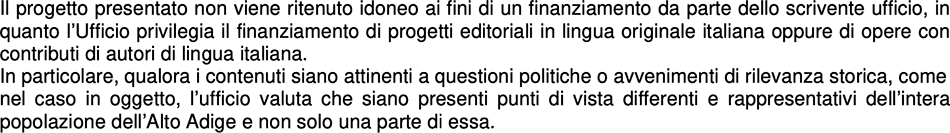[…] Mi risulta quindi assai pericoloso sostenere la tua ipotesi, in un contesto normativo attuale, altrimenti il grosso rischio sarebbe a carico delle minoranze linguistiche, che non sono (sic) certo quella tedesca, nonostante ci sia questa stortura normativa dov’è (sic) il gruppo linguistico tedesco è considerato la minoranza…
Christian Bianchi, attuale assessore provinciale (Uniti/Lega), in un commento su Facebook, 1 dicembre 2023 (cfr.)
Oggi non ci sono rischi di assimilazione, la scuola deve dare a tutti le stesse opportunità.
[…]
Nell’Alto Adige /Suedtirol del terzo millennio, in cui non incombe sulla minoranza tedescofona nessun pericolo/minaccia di assimilazione, la domanda è se il sistema scolastico pubblico altoatesino/sudtirolese sia strutturato in modo da formare i futuri cittadini offrendo a tutti le stesse opportunità.
Vanda Carbone (ex PD) in L’Svp gioca col fuoco, Salto, 30 agosto 2024 (cfr.)
Quindi chi parla di pericolo di nuova italianizzazione onestamente o non sa cosa dice, oppure è in malafede.
Luca Fazzi, professore di sociologia presso l’Università di Trento, in La paura dei barbari, Salto, 30 agosto 2024 (cfr.)
[D]ass Südtirol nicht mehr nur aus Deutschen, Italienern und Ladinern besteht, dass die benachteiligte Minderheit in Südtirol nicht mehr die deutsche, sondern die italienische Sprachgruppe ist.
Georg Mair, Chefredakteur, in Die Autonomie sind wir, ff Nr. 37/2024 vom 12. September 2024 (vgl.)
Die deutsche Sprache und Sprachgruppe ist nicht mehr gefährdet; die italienischsprachige Bevölkerung hat den Wert von Deutschkenntnissen erkannt, stößt aber auf Barrieren; und die urbanen Räume haben sich zu europäischen Migrationsgesellschaften entwickelt.
Hans Karl Peterlini, Bildungswissenschafter, in Taugt sie noch?, ff Nr. 38/2024 vom 19. September 2024
I favorevoli all’ipotesi delle classi speciali lamentano il rischio della perdita dell’identità linguistica dei bambini della minoranza/maggioranza in lingua tedesca e evocano lo spettro di un nuovo fascismo[.]
[…]
L’Autonomia della provincia di Bolzano è oggi saldamente ancorata a livello internazionale e con buona pace degli irredentisti di destra e di sinistra locali, non c’è più alcun pericolo di assimilazione.
Luca Fazzi, professore di sociologia presso l’Università di Trento, in Dalla parte dei bambini, Salto, 28 settembre 2024