Die international erfolgreiche Sängerin und Komponistin Björk hat vorgestern in den sozialen Medien ein Posting veröffentlicht, in dem sie sich — auch angesichts Trump’scher Drohungen — klar hinter die staatliche Unabjängigkeit von Kalaallit Nunaat (aka Grönland) stellt. Dabei zieht sie Parallelen zu ihrer Heimat Island, die sich 1944 ebenfalls von Dänemark lossagte. Nur so habe die isländische Sprache bewahrt werden können, so Björk — andernfalls würden ihre Kinder heute Dänisch sprechen.
Kolonialismus habe ihr immer wieder kalte Schauer über den Rücken gejagt, schreibt Björk, und sie wolle sich gar nicht vorstellen, dass die Grönländerinnen, für die sie tiefe Sympathie empfinde, von einer Kolonialmacht zur nächsten geraten könnten. »Úr öskunni í eldinn« — »aus der Asche ins Feuer«, also vom Regen in die Traufe —, so beschreibt sie diese Gefahr in Anspielung auf die unverhohlenen Ansprüche der USA.
Abschließend fordert Björk die Grönländerinnen explizit dazu auf, dem isländischen Beispiel zu folgen und ebenfalls die Unabhängigkeit zu erklären.
Ich selbst weiß als überzeugter Befürworter von Selbstbestimmung und Entkolonialisierung allerdings nicht, ob Kalaallit Nunaat diesen Schritt tatsächlich schon jetzt gehen sollte — zumindest nicht, ohne sich zuvor einem Schutzbündnis angeschlossen zu haben und/oder über verlässliche Schutzmächte für seine staatliche Souveränität zu verfügen.
Vor dem russischen Überfall auf die Ukraine und der Wiederwahl Donald Trumps hätte ich solche Überlegungen vielleicht als Angstmacherei abgetan, doch die Zeiten — die internationale geopolitische Lage — haben sich grundlegend zum Schlechteren verändert.
Für eine dünn besiedelte Insel, die aufgrund ihrer strategischen Lage und ihrer Rohstoffe die Begehrlichkeiten der USA, Russlands und Chinas gleichermaßen weckt, vermute ich erhebliche Risiken. Heute ist Kalaallit Nunaat zwar Teil der NATO, doch selbst das scheint das mächtigste Mitglied dieses Bündnisses nicht davon abzuhalten, offen mit einem Einmarsch zu drohen. Als unabhängiger Staat wäre Grönland, das anders als seine Kolonialmacht Dänemark nicht zur EU und zur Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) gehört, nahezu auf sich allein gestellt.
Vermutlich wäre es daher klüger, Entkolonialisierung und staatliche Unabhängigkeit im Fall von Kalaallit Nunaat weniger als ein einmaliges, kurzfristiges Ereignis zu begreifen, sondern vielmehr als einen sorgfältig abgesicherten Prozess. Ein abrupter Bruch birgt die Gefahr, ein Machtvakuum zu erzeugen, das externe Großmächte nur allzu bereitwillig als Einladung verstehen würden.

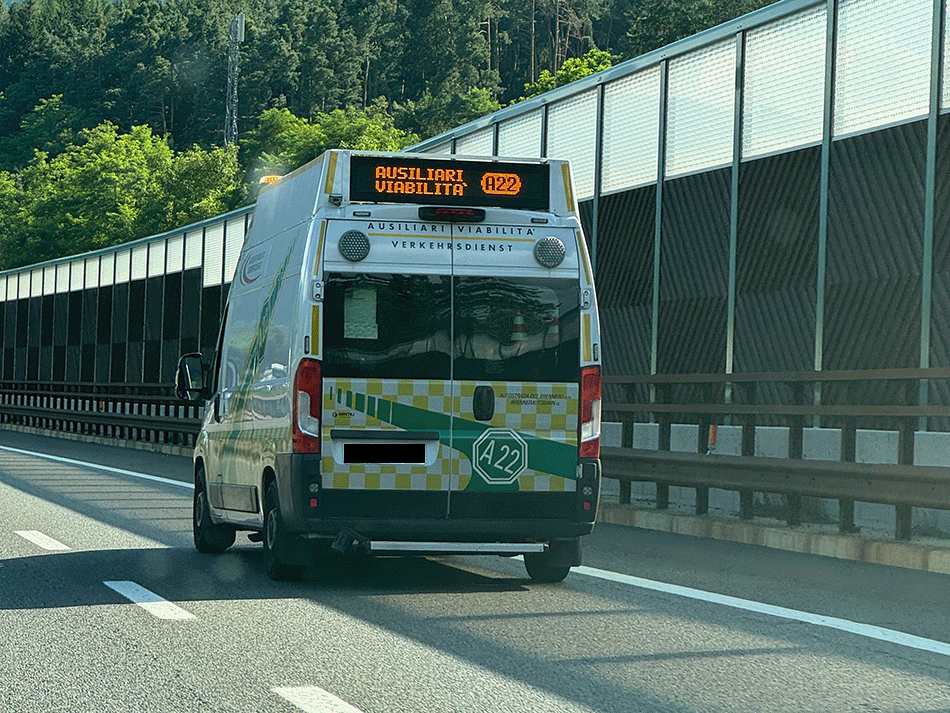
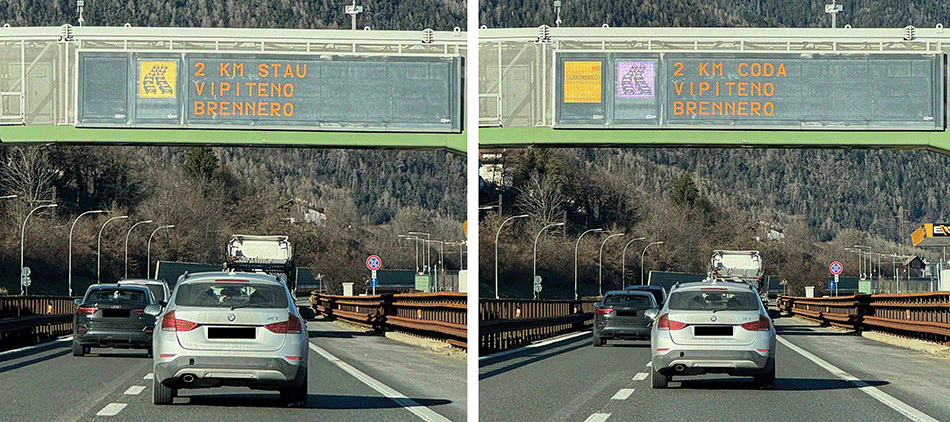

Kalaallit Nunaat